GEAB 178
Im Rahmen unserer Überlegungen zu Frankophonie, Mehrsprachigkeit und der Zukunft der internationalen Sprachen wollten wir uns mit Sven Franck, einem in Frankreich lebenden Deutschen, austauschen. Er ist außerdem Co-Listenführer in Frankreich bei den Europawahlen für Volt, eine paneuropäische Partei. Dies bietet uns die Gelegenheit, die Folgen der Schließung von drei Goethe-Instituten in Frankreich und die Auswirkungen der KI auf den interkulturellen Austausch, insbesondere in Europa, zu antizipieren.

Die deutsche Regierung hat beschlossen, die Goethe-Institute in Frankreich, in Lille, Bordeaux und Straßburg (!) zu schließen. Das sind zwar nicht alle Goethe-Institute in Frankreich, aber dennoch ist es meiner Meinung nach ein schlechtes Zeichen für die deutsch-französische Zusammenarbeit. Ich selbst lebe in Lille. Das Institut wurde dort vor über 60 Jahren eröffnet und 2023 ist auch das 60-jährige Jubiläum des Élysée-Vertrags, was die schlechte Symbolik der deutschen Entscheidung noch verstärkt (ganz zu schweigen von der Schließung des Instituts in Straßburg, der Hauptstadt des Europäischen Parlaments).
Im deutsch-französischen Vereinsumfeld waren wir eher mit Überlegungen beschäftigt, was aus dieser Zusammenarbeit in den nächsten 60 Jahren werden könnte. Wir hatten überhaupt nicht mit der Schließung der Goethe-Institute gerechnet. Ich war vor einigen Tagen zum Empfang des deutschen Botschafters in Frankreich in Paris eingeladen. Dort hatte ich Gelegenheit, ihn zu dieser Frage zu befragen. Er antwortete mir mit zwei Argumenten: Das erste ist eine finanzielle Überlegung, das zweite bezieht sich auf die Programme und Konzepte, die von den Instituten vermittelt werden. Meiner Meinung nach ist die Schließung nicht die einzige Lösung, wenn die Goethe-Institute ein Problem mit einem Programm oder ihren konkreten Aktivitäten haben, sondern es besteht immer die Möglichkeit einer Umstrukturierung oder einer Änderung des Auftrags. Man kann also davon ausgehen, dass die Frage der Finanzierung die Hauptbegründung für diese Entscheidung ist.
Ich bin in Lille Mitglied des Vereins für die Städtepartnerschaft zwischen Lille, Köln und Erfurt. Er ist auch ein Organ der deutsch-französischen Zusammenarbeit. Wir organisieren Aktivitäten mit dem Verein und erhalten manchmal Unterstützung vom Goethe-Institut. Diese Schließung, ohne andere Wege der Neuerfindung in Betracht zu ziehen, ist brutal.
Heute sprechen 130 Millionen Menschen Deutsch als Mutter- oder Zweitsprache. Deutsch ist eine Verfahrenssprache der Europäischen Union, also eine Amtssprache, und wird auch in Österreich, der Schweiz, Luxemburg, Belgien und Liechtenstein gesprochen[1]. Zwar werden heute in Frankreich Englisch und Spanisch dem Deutschen vorgezogen[2], vielleicht spielt die Schwierigkeit, Deutsch zu lernen, bei diesen Entscheidungen eine Rolle, aber vor dreißig Jahren war die Situation noch anders. Die Schließung des Goethe-Instituts wird vielmehr eine bereits laufende Tendenz beschleunigen: nicht nur die Abwanderung von Schülern, die Deutsch im Unterricht lernen (wie die untenstehende Kurve zeigt), und damit die Verdrängung des Deutschen aus dem Fremdsprachenpanorama (zumal die Sprache selbst in Deutschland die Tendenz hat, sich immer mehr zu anglisieren[3]), sondern vor allem die Verarmung der deutschen kulturellen Präsenz, für die die Institute das Referenzschaufenster und die Sprache das unverzichtbare Vehikel sind.

Abbildung 1 – Entwicklung der Schülerzahlen in der Sekundarstufe II nach erster lebender Fremdsprache (Englisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch) in den Schulen des französischen Bildungsministeriums (Education Nationale). Quelle: Französisches Bildungsministerium
Das europäische Motto lautet „In Vielfalt geeint“, nicht nur von Völkern, sondern auch von Sprachen und Kulturen[4]. Trotz des Brexit bleibt Englisch eine Verfahrenssprache der EU und vor allem weitgehend vorherrschend. Die Situationen sind länderspezifisch, man denke nur an Spanien, das in jeder Autonomie eine Amtssprache hat. Natürlich wird es nie gelingen, eine einzige Sprache für alle durchzusetzen, das ist auch nicht der Sinn der Sache. Also sollte man eher eine offizielle Arbeitssprache haben — oder in Zukunft noch besser, man sollte mehrere haben, mit Übersetzungen als Unterstützung. Aufgrund ihrer geopolitischen Ambitionen erscheint es mir nicht schockierend, dass die EU Englisch als eine ihrer Sprachen beibehält, um für den Rest der Welt offen zu bleiben und eine globale Sprache zu beherrschen. Die Mehrsprachigkeit auf europäischer Ebene entspricht jedoch sowohl den internen Herausforderungen (seien sie politischer, kultureller oder sozialer Natur) als auch der Öffnung gegenüber dem Rest der Welt.
Dann müssen wir darüber nachdenken, wie sich die künstliche Intelligenz (KI) in den nächsten Jahren auswirken wird. Wir sehen bereits die sehr guten Ergebnisse von Programmen wie DeepL oder ChatGPT. Ich arbeite im Bereich der freien Software und sage immer, dass Open Source die Voraussetzung für Interoperabilität ist. Das ist bei Sprachen genauso, Grammatik und Vokabular müssen offen und für jeden zugänglich sein. Software, die eine Übersetzung in Echtzeit (simultan gesprochen/geschrieben, automatisch, sofort…) und perfekt ermöglicht, wird immer besser werden. Für mich träume ich also in der Zukunft davon, dass jeder seine Muttersprache im internationalen Austausch beibehalten kann, vielleicht eine oder zwei Verfahrenssprachen lernt, um in der Lage zu sein, ohne Hilfe der Technologien zu kommunizieren. Aber ich bin überzeugt, dass wir sehr bald Lösungen haben werden, die jede Sprache in Echtzeit übersetzen können. Diese Werkzeuge können dazu beitragen, unsere Vielfalt und damit unseren Reichtum zu bewahren[5].
Aber es bleibt wichtig, mehrere Sprachen lernen und sprechen zu können, insbesondere als europäischer Bürger, denn eine Fremdsprache zu sprechen bedeutet, eine neue Perspektive einzunehmen, sich einem neuen Ideenkonstrukt zu nähern und die verschiedenen Sensibilitäten im Ausdruck der Kommunikation zu begreifen. Diese Perspektive ist nur möglich, wenn man die betreffende Sprache spricht, um einen Blickwinkel außerhalb der eigenen Muttersprache einzunehmen. Je mehr Sprachen wir sprechen, desto mehr sind wir in der Lage, unterschiedliche Kulturen und Gedanken zu umarmen. Auch wenn die Technologie das Übersetzen ersetzen wird, sollte sie nicht die Notwendigkeit ersetzen, mehrere Sprachen zu lernen. In der Volt-Partei sind wir direkt mit diesen Herausforderungen konfrontiert: Wie können wir eine europäische Bewegung mit all den verschiedenen Sprachen, aber ohne die Übersetzungsmöglichkeiten der EU-Institutionen am Leben erhalten? Momentan arbeiten wir von Fall zu Fall mit unseren eigenen Übersetzungen, wir haben keine digitalen Übersetzungstools auf Bewegungsebene im Einsatz, auch wenn wir das Ziel haben, unsere gesamte Kommunikation kurzfristig in alle EU-Sprachen zu übersetzen.
Ich bin ziemlich optimistisch, was den Fortschritt der KI angeht. Ich glaube nicht, dass sie notwendigerweise alle Arbeitnehmer ersetzen wird, aber sie wird die Arbeitnehmer ersetzen, die nicht wissen, wie man sie benutzt. Je besser wir die Funktionsweise beherrschen, je sicherer wir mit den heute vielleicht noch neuen Werkzeugen umgehen können, desto mehr werden sie uns in der Zukunft dienen.
Um auf unsere unterschiedlichen Kulturen zurückzukommen: Ich habe das Gefühl, dass wir uns auf mehr Nationalismus zubewegen, auch auf französischer Seite. Die Errungenschaften der 60-jährigen Zusammenarbeit zwischen Frankreich und Deutschland müssen erhalten werden. Dies wird nicht durch die Schließung der Goethe-Institute oder eine stärkere Betonung der Nation anstelle der Zusammenarbeit geschehen. Das betrifft nicht nur die Sprache, sondern die Gesellschaft und die Kultur im Allgemeinen. Diese Offenheit ist absolut notwendig, um die bestehenden Verbindungen aufrechtzuerhalten, sie zu stärken und auch zu erweitern. Dies war einer der Vorschläge, die wir in unserem Weißbuch zum Élysée-Vertrag[6] für die nächsten 60 Jahre gemacht haben: nicht auf die deutsch-französische Zusammenarbeit fixiert bleiben, sondern nach Polen, nach Ungarn erweitern, um einen Bruch in der Europäischen Union zwischen diesen Ländern zu vermeiden. Nach dem Vorbild der deutsch-französischen Annäherung ist eine Erweiterung auf die mitteleuropäischen Mitgliedstaaten (die in einer zweiten Phase des europäischen Einigungsprozesses angekommen sind) notwendig, und sei es nur, um sie langfristig besser in das europäische Gefüge zu integrieren.
Ich hatte mir von diesen Institutionen mehr Kreativität erhofft. Die Schließung des Bestehenden, ohne auch nur zu versuchen, neue Initiativen und Projekte zu verankern, kann nur dazu beitragen, dass sich die europäischen Völker voneinander abkoppeln, den Nationalismus stärken und die Zirkulation dessen verarmen lassen, was den Reichtum, die Energie und die Attraktivität Europas für seine Bürger, aber auch für die Welt ausmacht: seine Sprachen und seine Kulturen.
Diskussion in der GEAB Community auf LinkedIn.
__________________
[1] Quelle: Deutschland.de, 04/09/2023
[2] In Frankreich ist 2019 in der Sekundarstufe die am häufigsten gewählte Fremdsprache in der ersten studierten Sprache Englisch (96%) gegenüber 2,8% für Deutsch und in der zweiten studierten Sprache steht Spanisch mit 72,2% gegenüber 16,3% für Deutsch an erster Stelle. Quelle: Französisches Bildungsministerium
[3] In vielen Firmen braucht man ohnehin kein Deutsch mehr“ Quelle: Merkur, 10/02/2023. Siehe auch: Denglisch statt Deutsch – aber warum? Quelle: DerStandard, 09/10/2023.
[4] In Artikel 3 des Vertrags über die Europäische Union heißt es im letzten Absatz: „Sie achtet den Reichtum ihrer kulturellen und sprachlichen Vielfalt und sorgt für den Schutz und die Entwicklung des europäischen Kulturerbes“. Quelle: Eur-Lex
[5] „Die Sprache Europas ist die Übersetzung“, sagte Umberto Eco. Quelle: ICEO, 21/05/2019. Im Jahr 2010 präsentierte Franck Biancheri (unser GEAB-Gründer) im Rahmen der von der spanischen EU-Ratspräsidentschaft initiierten Bürgeragenda für Wissenschaft und Innovation, „Reto2030“, einen Vorschlag: „Überwindung der Sprachbarrieren in Europa durch Technologie“. Quelle: AAFB
[6] „Den Elysée-Vertrag neu erfinden“ – Weißbuch Januar 2023, Volt Europa
Der Übergang von der Welt "vorher" zur Welt "nachher", den wir in unseren Publikationen so oft analysiert und kommentiert haben, setzt sich fort. Dieser Übergang stellt sich heute in einem [...]
Es ist nur logisch, dass die internationale Regierungsführung, die vom Westen nach zwei Weltkriegen erfunden wurde, um Bedingungen für den Frieden zu schaffen, basierte auf der Verteidigung schwacher Akteure (Palästinenser, [...]
Trotz der "antifranzösischen Stimmung", die derzeit in Afrika herrscht und auf einen Attraktivitätsverlust Frankreichs hindeutet, erwarten wir, dass die französische Sprache weltweit wieder an Dynamik gewinnen wird. Der beste Beweis [...]
Wälder sind weit mehr als nur grüne Landschaften. Sie sind wichtige Ökosysteme, Zentren der Biodiversität, die eine zentrale Rolle bei der Aufrechterhaltung des ökologischen Gleichgewichts und der menschlichen Existenz spielen. [...]
Ein Jahr globale Rezession: Navigieren in der New Economy Im September verzeichnete der monatliche JP Morgan Global manufacturing PMI zum zwölften Mal in Folge eine weltweite Rezession. Genau wie wir [...]
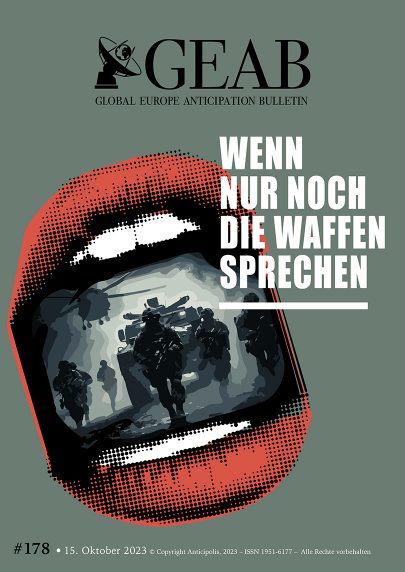

Kommentare